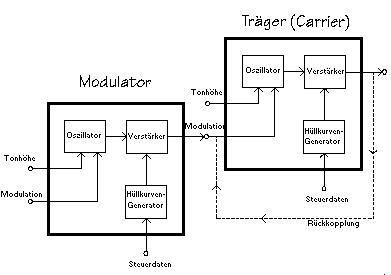
3 Erzeugung von synthetischen Klängen
Der Begriff "Vertikale Synthese" bezeichnet solche Verfahren, die durch Veränderung des Klangfrequenzspektrums zu jeweils einem Zeitpunkt oder innerhalb eines kurzen Zeitfensters wirken.
- Klangerzeugung durch Oszillatoren
Für die Erzeugung von Schwingungen wird eine spezielle elektronische Baugruppe verwendet, ein sogenannter Oszillator. Es können bestimmte Kurvenformen erzeugt werden (Sinus, Dreieck, Sägezahn, Rechteck und Puls), die das Ausgangsmaterial für die Klangerzeugung darstellen. Der klassische analoge Oszillator ist spannungsgesteuert, d.h. die Tonhöhe und Toneigenschaften werden durch eine Steuerspannung kontrolliert (Voltage Controlled Oscillator = VCO).
Bei der digitalen Klangerzeugung wird quasi ein Oszillator per Programm simuliert und eine bestimmte periodische Wellenform konstruiert.
- Filterung
Durch den Einsatz eines Filters kann das Frequenzspektrum eines Klanges verändert werden und damit eine neue Klangfarbe (bei gleichbleibender Tonhöhe und Lautstärke) erzeugt werden. Ein solcher Filter schwächt bestimmte Frequenzbereiche ab oder blendet sie ganz aus. Je nach Frequenzbereich, in dem der Filter wirksam ist, wird unterschieden nach Tiefpaßfilter (läßt tiefe Frequenzen unverändert und dämpft höhere), Hochpaßfilter (wirkt umgekehrt wie der Tiefpaß), Bandpaßfilter (hebt einen bestimmten Frequenzbereich hervor) und Bandsperrfilter (entfernt einen bestimmten Frequenzbereich). Eine Regelung der Filter erfolgt über die Einstellung der Eckfrequenzen, das sind die Grenzwerte, oberhalb bzw. unterhalb von denen der Filter wirksam wird. Dabei wird der Übergang von ungefilterten zu gefilterten Bereichen allmählich ansteigend bzw. abfallend gestaltet; die Flankensteilheit bestimmt, über welchen Frequenzbereich sich die Übergangszone erstreckt. Ein üblicher Wert beträgt eine Dämpfung von 12 dB pro Oktave.
Das Filterverfahren wird auch als subtraktive Synthese bezeichnet, weil ausgehend von einem komplexen Klang durch Subtraktion bestimmter Frequenzbereiche eine veränderte Klangfarbe erzeugt wird.
- Hüllkurven (ADSR - Attack, Delay, Sustain, Release)
Ein einzelner Klang, der z.B. von einem Klavier erzeugt wird, zeichnet sich durch typische Veränderungen im zeitlichen Verlauf des Klanges aus, wie der Anschlagphase, einer Phase des eigentlichen vollen Klanges und einer Ausschwingphase. Das allgemeine Modell dieses Ablaufes umfaßt die Phasen Attack, Decay, Sustain und Release (ADSR) und wird Hüllkurve genannt. Bei der synthetischen Erzeugung von Instrumentenklängen wird die Lautstärke jedes Einzelklanges über seine Zeitdauer nach einer solchen Hüllkurve verändert.
- Frequenz Modulation (FM-Synthese)
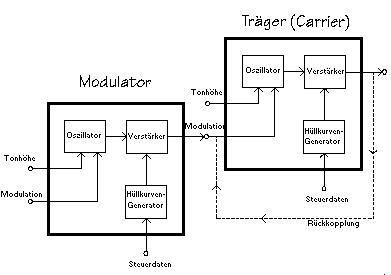
In der Musiksynthese durch Frequenz-Modulation werden mehrere Oszillatoren miteinander kombiniert. Das Ausgangssignal eines Oszillators (des Modulators) wird verwendet, um die Frequenz eines zweiten Oszillators (des Carriers) zu modulieren. Bereits durch leichte Variationen in den Einstellungen des Modulators läßt sich eine Vielfalt von Klangfarben erzeugen. Allerdings läßt sich dabei keine Entsprechung zu spezifischen Klängen vorhersagen, sondern es muß durch trial und error ermittelt werden, welche Kombinationen zu verwertbaren und interessanten Klängen führen.
Dieses Verfahren wurde von John Chowning entwickelt und von der Firma YAMAHA in dem Synthesizer DX7 eingesetzt.
Das Verfahren fand ebenfalls Verwendung in einem Soundchip der Firma YAMAHA, dem
OPL3-Chip, der auf zahlreichen Soundkarten zu finden ist und ein preiswertes Modul zur
Erzeugung von General Midi Sounds darstellt.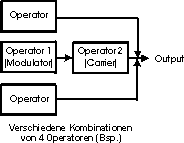 Der OPL3-Chip enthält einen Synthesizer mit
4 Oszillatoren (Operatoren genannt), die in verschiedenen Kombinationen zur
Klangerzeugung eingesetzt werden, um die unterschiedlichsten Klänge zu erzeugen.
Der OPL3-Chip enthält einen Synthesizer mit
4 Oszillatoren (Operatoren genannt), die in verschiedenen Kombinationen zur
Klangerzeugung eingesetzt werden, um die unterschiedlichsten Klänge zu erzeugen.
| 2 Operatoren, Additive Synthese | |
| 2 Operatoren, Frequency Modulation | |
| 4 Operatoren Modus, FM-FM, AM-FM, FM-AM, AM-AM |
- Definition
Im Gegensatz zur vertikalen Synthese, in der durch Aufeinanderschichten von Elementen innerhalb eines Zeitfensters Klänge realisiert, meint die horizontale Synthese die Komposition der Klangfarbe in der Zeit durch zeitliches Aneinanderreihen von kurzen Klangeinheiten. Ein anschauliches Beispiel ist die Zeichnung einer Wellenform auf dem Computerbildschirm (mit Maus oder Lichtgriffel), die dann als Vorlage für die Klangerzeugung genutzt wird.
- Sampling
Unter Sampling versteht man ein digitales Verfahren zur Speicherung von Klängen. Das kontinuierliche analoge Signal wird mittels eines Analog/Digital-Wandlers in diskrete Zahlenwerte umgewandelt. Für die Qualität sind zwei Parameter entscheidend:
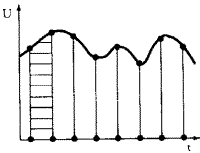
Hohe Qualität bedeutet also viele und lange Zahlenwerte pro Zeiteinheit und damit einen hohen Datendurchsatz und hohen Speicheraufwand.
Typische Manipulationen des Samplingsignals sind Beeinflussung von Tonhöhe und Geschwindigkeit beim Auslesen eines Samples (pitching / time stretching):
Diese Manipulationen gehen zu Lasten der Originaltät des Signals. Nehmen wir das Beispiel eines Klaviertones: Man könnte auf die Idee kommen, nur einen Ton samplen zu wollen und alle anderen Töne durch Transponieren zu erzeugen. Allerdings ändert sich mit der Höhe des am Klavier angeschlagenen Tones auch sein Klangcharakter. Dieser Charakterwechsel wird durch das Transponieren nicht berücksichtigt. Folge: Die transponierten Töne klingen unnatürlich. Nächstes Problem: Auch die Stärke des Anschlages entscheidet über den Klangeindruck, der sich nicht nur in der Lautstärke verändert. Durch Multisampling, also das Sampling von vielen Tonhöhen bei vielen Anschlagsstärken kann man die Natürlichkeit des synthetisierten Klanges verbessern.
Neben der Möglichkeit, eigene Samples zu erstellen, gibt es für viele Geräte, die nach diesem Verfahren arbeiten, zum Teil große Soundbibliotheken.
- Resynthese
Die Resynthese beruht auf der Idee, nicht das Signal selbst sondern Transformationen des Signales abzuspeichern, diese Transformationen gegebenenfalls zu modifiziernen und erst zur Wiedergabe zurückzuwandeln.
Der erste Schritt ist die spektrale Analyse des Signals unter Verwendung der Fast Fourier Transformation (FFT): Diese Transformation wird nicht auf das akustische Ereignis als ganzes sondern bezogen auf hinreichend kleine und gleichlange Zeitfenster ausgeführt. Man erhält so die Frequenzzusammensetzung eines jeden Zeitfensters. Damit es bei der späteren Rückwandlung keine großen Sprünge gibt, sollen sich die Zeitfenster leicht überlappen. Die Transformationen können dann durch geeignete Macro-Funktionen modifiziert werden. Über das Weglassen von Obertönen ist es möglich, die Größe und Qualität der Transformationen zu variieren. Zur Wiedergabe findet eine Rückwandlung und Aneinanderreihung der Zeitfensterinhalte statt.
Der Vorteil dieses Verfahrens soll in der präziseren Signalspeicherung bei gleichzeitig geringerem Speicheraufwand im Vergleich zum Sampling liegen.
- Physical Modeling
Auch diese Syntheseart will nicht das Signal selbst sondern die relevanten physikalischen Vorgänge im erzeugenden Instrument abspeichern. Anstelle der ausschließlichen Nachbildung des klanglichen Ergebnisses erfolgt hier Simulation der mechanisch-akustischen Abhängigkeiten traditioneller Musikinstrumente. Dazu wird das zu simulierende Instrument in Einheiten untergliedert, denen stellvertretend passende Simulatoren zugeordnet werden. Die Wiedergabe eines Klanges erfolgt durch Hintereinanderschaltung solcher virtuellen Klangerzeugungsräume. Betrachten wir dieses am Modell einer Klarinette:
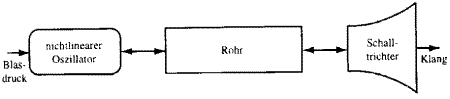
Durch die Modularität der Klangerzeugungselemente lassen sich diese beliebig und damit auch ungewohnt zusammenstellen. Beispiel: Das Anblasen einer Geige wird auf diese Weise simulierbar.